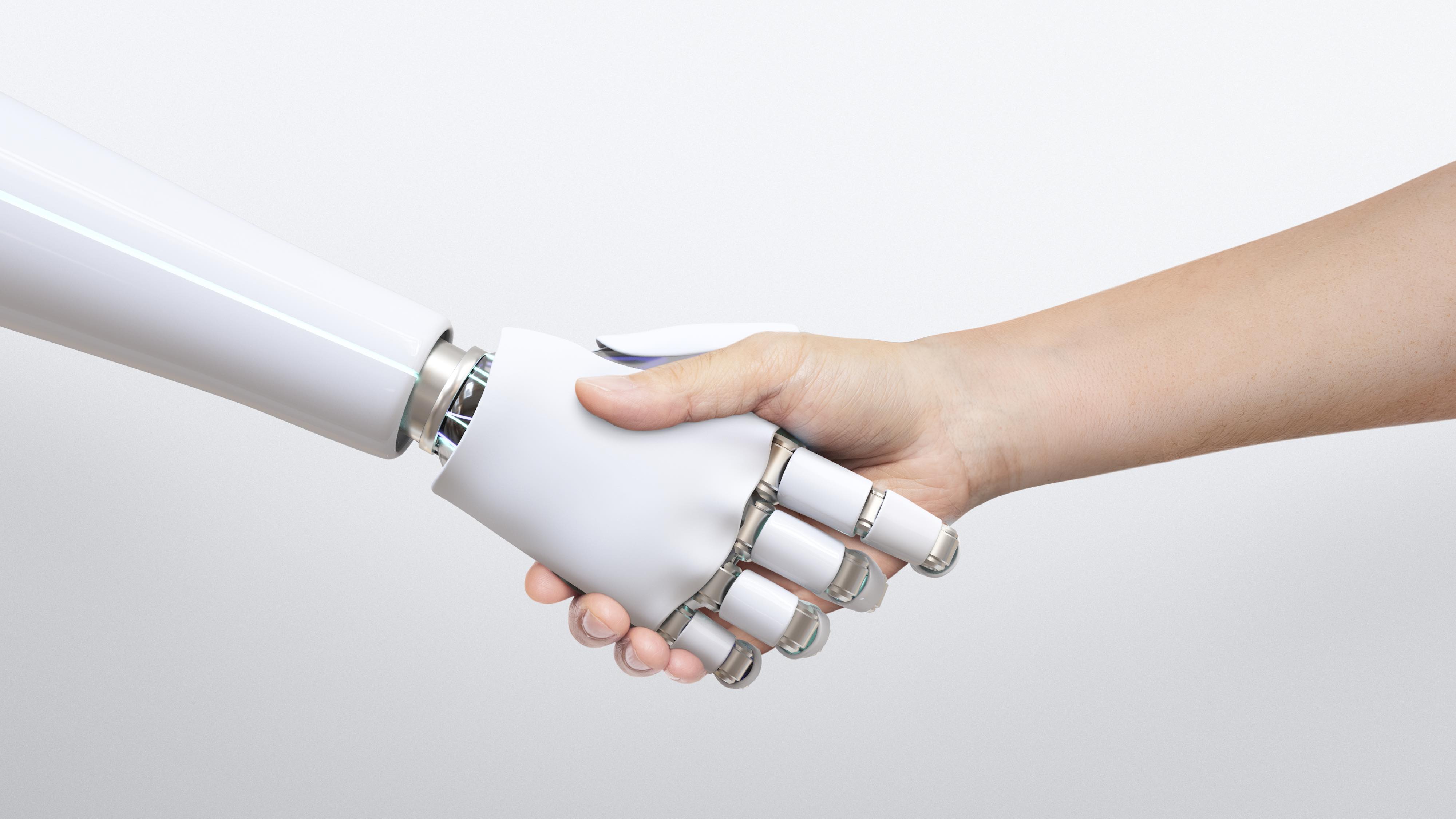Sicherheit & Rechtliches
Die Bürgerinnen und Bürger der beteiligten Gemeinden erkundigten sich zur Sicherheit des 5G-Campusnetzes und zur Sicherheit der Drohnen. Im Folgenden wurden die gestellten Fragen vor allem von Herrn Professor Michael Stöber und seinen Kollegen vom Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, deutsches und internationales Steuer-, Handels- und Wirtschaftsrecht sowie Zivilverfahrensrecht an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel beantwortet. Der Partner erforscht im Rahmen des Projekts die rechtlichen Fragestellungen, die sich durch die vielfältigen und innovativen Anwendungsfälle ergeben.
Die Herstellung der 5G-Hardware erfüllt die 3GPP-Standardisierung. 3GPP steht für 3rd Generation Partnership Project und beschreibt ein internationales Gremium, welches sich mit der Gewährleistung der Datensicherheit, also dem technischen Schutz der Daten, auseinandersetzt und die Standards des Mobilfunks fortwährend diskutiert, überarbeitet und umsetzt.
Beispiele für Themen, die in regelmäßigem Austausch angepasst werden, sind Integrität, Verschlüsselung der Daten und Vertraulichkeit. Laut Veröffentlichung vom August 2020 schreibt der Katalog folgende Anforderungen fest:
- Kritische Komponenten müssen zertifiziert werden,
- Hersteller und Lieferanten müssen Vertrauenswürdigkeitserklärungen vorlegen,
- Die Produktintegrität muss sichergestellt sein,
- Ein Sicherheitsmonitoring wird eingeführt,
- An Personal in sicherheitsrelevanten Bereichen gelten besondere Anforderungen,
- Ausreichende Redundanzen, also technische Reserven für Ausfälle, werden gewährleistet, und
- Monokulturen müssen vermieden werden, das heißt: Im Kernnetz und im Funkzugangsnetz braucht es Komponenten von mindestens zwei Herstellern.
Für 5G gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz und dem Schutz der Privatsphäre, die in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und der europäischen ePrivacy-Richtlinie festgehalten sind. Diese sichern die Kontrolle der Betroffenen über ihre personenbezogenen Daten. Da 5G-Netze genaue Standort- und Bewegungsprofile erfassen können, ist der Schutz dieser sensiblen Daten für eine sichere Zukunft mit 5G wichtig. Die sensiblen Verkehrs- und Standortdaten werden zusätzlich durch strengere Regeln der ePrivacy-Richtlinie und des Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetzs (TTDSG) geschützt. Gemäß DSGVO dürfen Informationen auf Geräten nur mit Zustimmung gespeichert oder abgerufen werden. Standortdaten dürfen ohne Einwilligung des Nutzers praktisch nicht verarbeitet werden, unabhängig davon, ob es sich um personenbezogene Daten oder andere Arten von Informationen handelt.
Quelle: Deutschland spricht über 5G: Datenschutz und Datensicherheit 5G und Privatsphäre: Diese Regeln schützen Ihre DatenIn Deutschland überwachen verschiedene Institutionen den Datenschutz und die Datensicherheit. Die Bundesnetzagentur ist zuständig für die Aufsicht im Bereich der Telekommunikation und die Einhaltung der Vorschriften. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) überwacht speziell den Datenschutz in den Bereichen Telekommunikation und Post. Der BfDI stellt sicher, dass die DSGVO-Anforderungen zum Schutz personenbezogener Daten erfüllt werden. Bürgerinnen und Bürger können sich mit Fragen und Beschwerden an den Bundesbeauftragten wenden. Die unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden der Bundesländer sind ebenfalls für die Überwachung des Datenschutzes zuständig, z. B. in Schleswig-Holstein das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz.
Quelle: Deutschland spricht über 5G: Datenschutz und Datensicherheit 5G und Privatsphäre: Diese Regeln schützen Ihre DatenDie Projektbetreiber legen viel Wert darauf, die Drohnen im technisch stets einwandfreien Zustand zu halten und regelmäßig zu untersuchen, um alle eventuell auftretenden technischen Fehlfunktionen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Der Auftritt größerer Schäden erscheint wegen der geringen Masse und der verhältnismäßig niedrigen Geschwindigkeit der im Rahmen des Projekts eingesetzten Drohnen nicht besonders wahrscheinlich. Dennoch kann natürlich niemals völlig ausgeschlossen werden, dass eine technische Fehlfunktion plötzlich auftritt und im schlimmsten Fall einen Absturz der Drohne verursacht, der zu Schäden für Menschen, Tiere und/oder Sachen führen kann. Für diese Schäden wird die Haftpflichtversicherung aufkommen, die für den Betrieb von Drohnen nach Vorgaben des deutschen Rechts zwingend abgeschlossen werden muss.
Quelle: Christian-Albrechts-Universität zu KielDa für die Drohnen nach deutschem Recht zwingend eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden muss, werden die Schäden, die für Menschen, Tiere und Sachen durch den Absturz der Drohne verursacht werden, durch diese Haftpflichtversicherung ersetzt. Die Schäden werden unabhängig davon ersetzt, warum die Drohne abgestürzt ist. Es spielt also keine Rolle, ob der Absturz der Drohne durch einen menschlichen oder technischen Fehler verursacht wurde oder ob andere Ursachen maßgeblich waren, wie z. B. ein Unwetter. Die Schäden an der Drohne selbst werden von einer hierfür zusätzlich abgeschlossenen Versicherung getragen, sofern die Projektbetreiber sich für den Abschluss einer solchen Versicherung entscheiden. Falls eine solche Versicherung für die Drohne selbst nicht abgeschlossen wird, werden die Projektbetreiber die Schäden der Drohne selbst tragen müssen.
Quelle: Christian-Albrechts-Universität zu KielBereits während der Entwicklung der Drohnen wird auf Sicherheit streng geachtet, sodass relevante Maßnahmen direkt in den Entwicklungsprozess einfließen. Mittels Modellierung der Drohnen wird eine vereinfachte Form der Realität abgebildet, welche die künftig wichtigsten Aspekte und Funktionen darstellt, um erste Sicherheitsbetrachtungen vorzunehmen. Außerdem wird ein Sicherheitskonzept erstellt, um die Drohnen vor einem Hackerangriff zu schützen. Diejenigen Stellen der Drohne, die besonders anfällig für Angriffe sind, werden besonders genau untersucht und abgesichert.
Quelle: Christian-Albrechts-Universität zu KielDrohnenaufnahmen können genauso wie alle anderen Video-, Bild- und Tonaufnahmen als Beweismittel vor Gericht grundsätzlich genutzt werden. Für Aufnahmen, die speziell mit Drohnen erstellt wurden, gelten keine Sonderregelungen. Daher gelten die allgemeinen, auch in allen anderen Fällen anwendbaren Regeln für die Beweisführung mit Video-, Bild- und Tonaufnahmen. Einschränkungen für die Beweisführung anhand der Drohnenaufnahmen können sich – wie auch im Falle von anderen Video-, Bild- und Tonaufnahmen – aus den Rechten der anderen Personen ergeben, falls diese bei Erstellung der Drohnenaufnahmen verletzt werden. In problematischen Fällen nehmen die Gerichte eine umfassende Abwägung aller betroffenen Interessen unter Einbeziehung der Persönlichkeitsrechte vor, um über die Zulässigkeit der Aufnahmen als Beweismittel im konkreten Fall zu entscheiden. In jedem Fall beabsichtigen die Projektbetreiber keine gezielte Anfertigung von Drohnenaufnahmen zwecks Beweisführung vor Gericht.
Quelle: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel